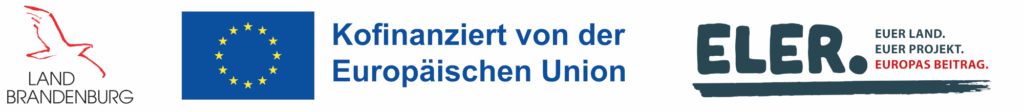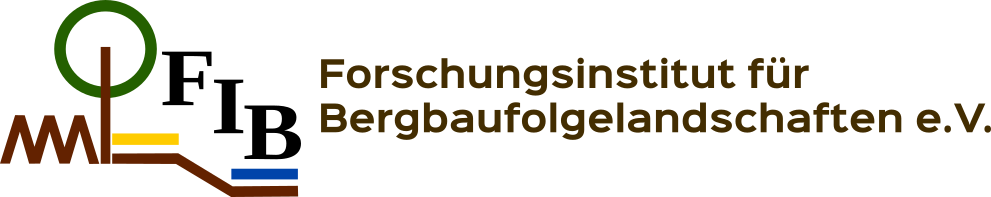Die Bewässerung landwirtschaftlicher Kulturen sichert die Existenz von Agrarbetrieben bei zunehmenden Trockenperioden. Bewässerungsbetriebe stehen dabei immer vor der Herausforderung, die pflanzenbauliche Notwendigkeit von konkreten Bewässerungseinsätzen und deren ökonomische Sinnhaftigkeit in Einklang zu bringen. Insbesondere bei den in Brandenburg bedeutsamen Kulturen wie Winterweizen, Wintergerste oder Mais ist die Wirtschaftlichkeit der Bewässerung nicht in jeder Situation gegeben.
Im Projekt „Entwicklung von Entscheidungshilfen für eine kosteneffiziente Bewässerung – Cost-Efficient Irrigation (CEFIR)“ soll die Wirtschaftlichkeit der Bewässerung vor dem Bewässerungseinsatz abgeschätzt werden. Das zu entwickelnde Entscheidungsunterstützungssystem (Decision Support System, kurz DSS) soll einerseits als einfach zu bedienende Web-App zur Verfügung gestellt und andererseits in eine vorhandene App zur Bewässerungssteuerung integriert werden. Die Entwicklung erfolgt gemeinsam mit Landwirtschaftsbetrieben, welche Ackerschläge mit Kreisbewässerungsanlagen für Praxistests zur Verfügung stellen. Landwirtschaftliche Feldbewässerung kann mit dem DSS kosteneffizienter und nachhaltiger werden.

Projektpartner
Die Operationelle Gruppe in dem Projekt wird von sieben Partnern aus der Wissenschaft, der Wirtschaft, der Landwirtschaft und der Beratung gebildet:
- Forschungsinstitut für Bergbaufolgelandschaften e.V. (FIB, Leadpartner und Koordinator)
- Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH Beerfelde
- Gollwitzer Agrar GmbH
- Hydro-Air international irrigation systems GmbH
- IT-Direkt Business Technologies GmbH
- Landwirtschaftliche Beratung der Agrarverbände Brandenburg GmbH
- Öko-Landbau Canitz GbR.
Förderer
Die Finanzierung erfolgt mit Mitteln der Europäischen Innovationspartnerschaft für Produktivität und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft (EIP-AGRI), eine Fördermaßnahme der Europäischen Union (EU) sowie mit Mitteln das Landes Brandenburg (MLEUV).