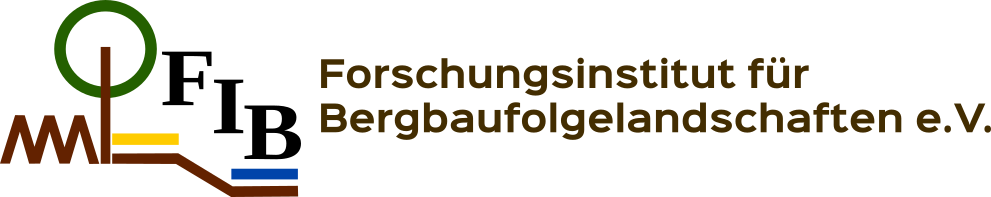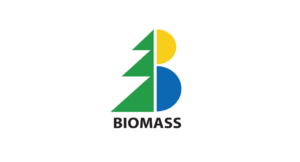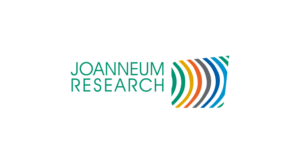Der Startschuss für die Entwicklung neuer Ideen ist im April gefallen. Das Forschungsinstitut für Bergbaufolgelandschaften (FIB) bearbeitet mit dem Teilprojekt „Wasser-Landschaft“ das Innovationsfeld rund um die Frage der Gewässer- und Bodensanierung sowie Landnutzung in Hinblick auf den anstehenden erneuten Strukturwandel in der Lausitz. Die Betrachtung erfolgt gemeinsam mit den Partnern IBA-Studierhaus Großräschen, BTU Cottbus-Senftenberg, Institut für Schwimmende Bauten sowie der Hochschule Zittau-Görlitz und dem Wassercluster Lausitz im Kontext des Gesamtprojektes „Innovationswerkstatt WASSER-LANDSCHAFT-LAUSITZ“.
Das BMBF fördert damit die Entwicklung eines Konzeptes zum „Wandel durch Innovation in der Region“. Unser Ziel ist es Innovationen und nachhaltige Wirtschaftsstrukturen in wichtigen Aspekten des Lausitzer Strukturwandels zu entwickeln und fördern.
- die Herstellung und Nachnutzung neuer Landschaften und Gewässer durch Sanierungstechnologien und Rekultivierungsverfahren (Innovationsfeld 1),
- deren Inwertsetzung durch nachhaltigen Tourismus und Industriekultur (Innovationsfeld 2)
- sowie durch Schwimmende Bauten (Innovationsfeld 3).
Das einmalige, regionale Knowhow soll auch künftig in der Lausitz verankert bleiben und die Grundlage für wertschöpfende Strukturen bilden. Die Entwicklung von Konzepten und Strukturen für einen überregionalen und internationalen Wissenstransfer sowie eine Vermarktung von Kompetenzen, Technologien und Produkten stellen übergeordnete Aufgabenfelder dar.
Haben Sie Ideen, die Sie einbringen möchten? Wenden Sie sich an uns!
Weitere Informationen:
http://www.iba-see2010.de/de/studierhaus/projekte/innowerkstatt.html
Projektpartner
IBA Studierhaus Großräschen, BTU Cottbus-Senftenberg
Förderer
Gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Förderkennzeichen: 03WIR2601B