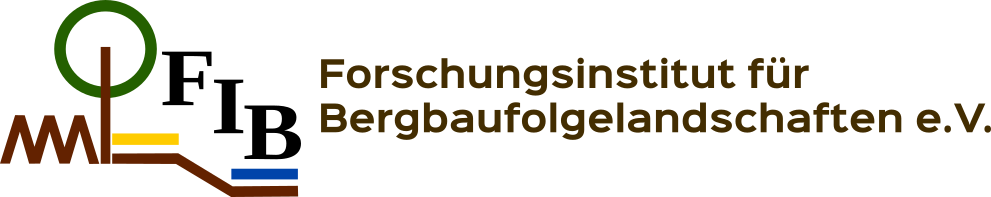Die Rekultivierung von Tagebauflächen leistet aus Sicht der Vattenfall Europe Mining AG (VEM) einen klimawirksamen Beitrag zur biogenen Kohlenstoffspeicherung. Ihr gegenüber steht jedoch die Kohlenstofffreisetzung bei der Inanspruchnahme des Tagebauvorfeldes. Bisher mangelt es jedoch an einer vor-/nachbergbaulichen Kohlenstoffbilanzierung und entsprechenden methodischen Ansätzen. Dabei ist insbesondere die Abschätzung der flächenbezogenen C-Sequestrierung in jungen Ökosystemen auf Neulandböden unsicher, da bisher kaum belastbare Primärdaten vorliegen.
Es soll nunmehr ein wissenschaftlich fundiertes Berechnungsmodell erarbeitet werden, das eine C-Bilanzierung auf der Grundlage zuverlässiger Eingangsdaten ermöglicht. Folgende Fragestellungen werden behandelt:
- Entwicklung und Validierung eines methodischen Ansatzes zur Bewertung der Kohlenstoff-Sequestrierung von Rekultivierungsflächen, Anwendung am Fallbeispiel des Tagebaus Welzow-Süd
- vergleichende Bilanzierung der biogenen C-Bindung (vor- und nachbergbaulich) für typische Flächenkategorien bzw. Biotoptypen mit Prognosen in die „ferne Zukunft“
- Inwertsetzung der Kohlenstoffspeicherung von Rekultivierungsflächen bzw. ihres Beitrags zum Klimaschutz (CO2-Zertifikate)
- Ableitung von Handlungsempfehlungen zur Beschleunigung der CO2-Fixierung von Rekultivierungsflächen und Erhöhung der Senkenleistung („Carbon Reclamation Management“)
Auftraggeber
- Vattenfall Europe Mining AG (VEM)