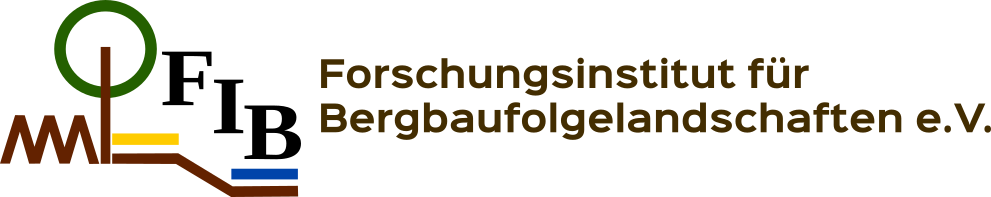Landeck, Ingmar
Wissenschaftliche Mitarbeitende
Ökologie / Naturschutz
| E-Mail-Adresse | i.landeck@fib-ev.de |
| Telefon | 0049 (0) 3531-7907 19 |

Abschlüsse
- Dipl.-Biol.
Lebenslauf
- seit 1993 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungsinstitut für Bergbaufolgelandschaften e. V. in Finsterwalde
- Studien- und Forschungsreisen nach Sibirien, O-Australien, Costa Ricas, Kreta, Bolivien, Teneriffa, Südafrika, NO-Türkei, N-Australien, NW-Kaukasus
- 1988 – 1993 Studium der Biologie an der Martin-Luther-Universität zu Halle – Wittenberg in Halle, Abschluss Diplom
Erfahrungen
- Ökologie
- Naturschutz
- Vegetationskunde
- Entomologie
- Naturschutzfachliches Monitoring
- Wurzelökologie
- Phytophagen in Kurzumtriebsplantagen
- Fauna und Flora Südbrandenburg
- Schulungen, Regionalkoordination in Südbrandenburg für das Tagfaltermonitoring Deutschland
Projekte
Potenzialstudie zu Erhalt und Förderung der Biodiversität in Offenlandlebensräumen in der Bergbaufolgelandschaft Sachsens
Wie viel für den Naturschutz bedeutsames Offenland gibt es in den Bergbaufolgelandschaften Sachsens? Wie kann es erhalten werden?
Bienenburgen – Citizen Science für ein Netzwerk aus Lebensinseln für Wildbienen
Dem Rückgang der Wildbienen in der Lausitz setzen wir mit dem Bürgerforschungs-Projekt „Bienenburgen“ aktiv etwas entgegen: Ein Rettungsnetz für die Wildbienen soll entstehen.
Etablierung von Blaubeeren in Kippenwäldern als Habitataufwertung für das Auerhuhn
Den Lebensraum des Auerhuhns zu vergrößern – das haben wir uns mit diesem Projekt vorgenommen. Auch Jahrzehnte nach der erfolgreichen Aufforstung fehlt in den meisten Kippenwäldern die Blaubeere, die jedoch eine wesentliche Lebensgrundlage für das Auerhuhn ist.
Heizen mit Heide – Erneuerbare Energie aus der naturschutzgerechten Landschaftspflege
Dieses Projekt realisiert in einem neuartigen Ansatz eine Win-Win-Situation: Das bei der Pflege von Zwergstrauchheiden anfallende Material wird zu Heidepellets verpresst: ein regionales Produkt, dass zur Pflege eines geschützten Biotoptyps beiträgt.
Modellprojekt nachhaltiger Weinbau mit Unkrautschutz durch biologisch abbaubare Mulchmatten
Auf Weinbauflächen im Saale-Unstrut-Kreis untersucht das FIB die Effekte biologisch abbaubarer Mulchmatten und -papiere auf die Verunkrautung, Wasserversorgung und Vitalität der Weinreben. Ziel ist ein ökologisch nachhaltiger Weinbau durch proaktiven Verzicht auf Herbizide.
Bewertung des Invasivitätspotenzials der Robinie in Brandenburg (InvaRo)
So wie mit der Robinie, die bislang mit dem Klimawandel gut zurechtkommt, große Hoffnungen verbunden werden, so werden seitens des Naturschutzes eher die Probleme ihrer Invasivität betont. Wir wollen zu einer Versachlichung der Debatte und Lösungsansätzen einer friedlichen Koexistenz beitragen.
Naturschutzfachliche Begleitung Tagebaufeld Schlabendorf
In diesem Projekt tragen wir zu einer naturschutzgerechten Sanierung der ehemaligen Braunkohlenkippen im Bereich Schlabendorfer Felder bei.
Sachstandsanalyse und Erarbeitung eines Konzeptes zur Reduzierung des Haldenwasseraufkommens durch Optimierung der Haldenbegrünung an den Kalirückstandshalden im Südharzrevier
Die Abdeckung und nachfolgende Begründung der thüringisches Kalirückstandshalden mit Haldenschutzwäldern soll dazu beitragen, dass weniger salzhaltiges Sickerwasser das Grund- und Oberflächenwasser beeinträchtigt. Hierzu entwickeln wir standortspezifische Ansätze und schätzen deren Wirksamkeit ein.
Untersuchung zur Düngung von Renaturierungsflächen, Gefäß- und Feldversuche im Tagebau Jänschwalde
.
Kartierung von Flora und Fauna für die Bereiche Lichtenauer See und Tornower Niederung im Sanierungsraum Schlabendorf
.
Initiierung von Calluna-Heiden auf Tertiärstandorten: Konzeption für wissenschaftliche Begleituntersuchungen
.
Langzeitwirkung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf Natur und Landschaft
.
Stubbenhecken in der Bergbaufolgelandschaft – Ein Beitrag zur Biologischen Vielfalt
.
Entwicklung und Erprobung eines Monitoringkonzepts am Beispiel der Bergbaufolgelandschaft Naturparadies Grünhaus
.
Weiterführende Untersuchungen zur Corixidenfauna an extrem sauren Gewässern im Raum Plessa
Untersuchung der Wechselwirkung von Standorteigenschaften und Waldentwicklung
.
Bestandsentwicklung, Gefährdungsanalyse und Konfliktmanagement für den Elbebiber am Gewässerlauf der Rainitza im Landkreis Oberspreewald – Lausitz
Bestandsaufnahme und Defizitanalyse der Feldgehölze auf den Agrarflächen der Kippen des Braunkohlebergbaus im Hinblick auf ihre Ausstattung, Strukturierung und Funktion sowie die Erarbeitung eines Anforderungskatalogs für die Gestaltung vielfältig und nachhaltig wirksamer Flurgehölzsysteme
.
Kartierungsberichte zur Kartierung von Bodenvegetationstypen in Sachsen I. Versuchsflächen im FoA Wermsdorf, Rev. Hubertusburg II. Versuchsflächen im FoA Falkenberg, Rev. Gräfendorf und Roitzsch
Biologische und geotechnische Begleitung eines Versuchsprogramms zur Beweidung durch Schafe auf einer sanierten Fläche der Halde 366
Charakterisierung der Substrateigenschaften repräsentativer Lokalbodenformen in Sachsen im Hinblick auf Befahrungssensibilität und Wasserhaushalt
.
Aufklärung und Quantifizierung von Zusammenhängen zwischen Standorteigenschaften auf der Basis von Substrateigenschaften und Lokalbodenformen, der Entwicklung von Bodenvegetationstypen und der Vitalitäts- und Wachstumsentwicklung von Baumarten
.
Feldversuche zum nachträglichen Bodenauftrag in verschiedene Gehölzbestände auf dem Plateau der Hammerberghalde der NL Aue
Alternative Sanierungskonzeptionen für die Halden 309 und 310 der WISMUT-Niederlassung Aue unter dem Aspekt einer gezielten Begrünung
.
Waldumbau der Kippenerstaufforstungen zur Nachhaltsicherung der forstlichen Nutzung
Waldumbau der Kippenerstaufforstungen zur Nachhaltsicherung der forstlichen Nutzung