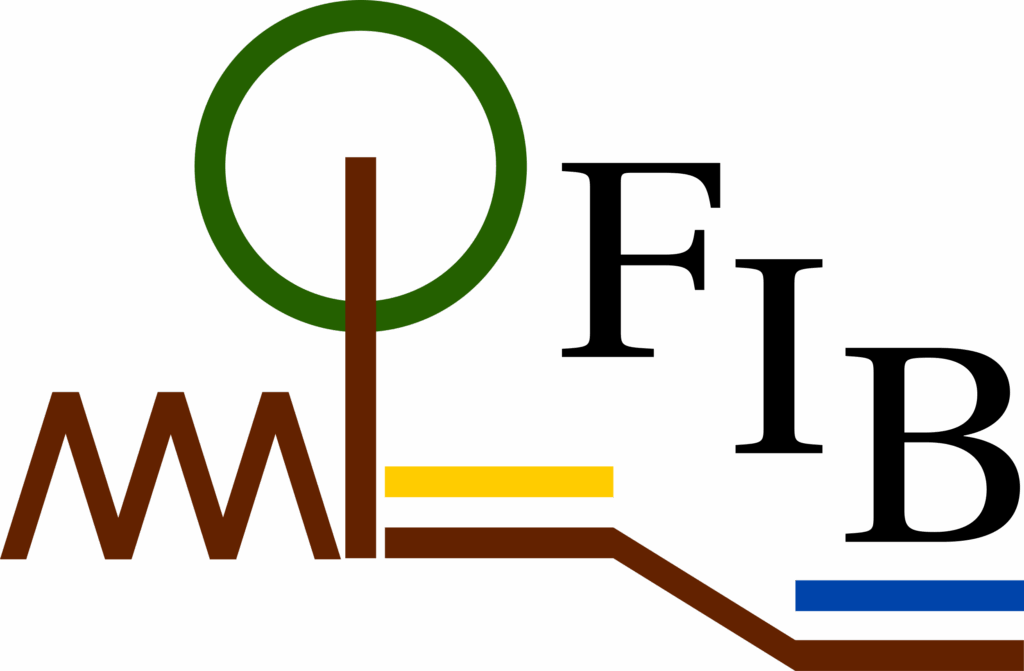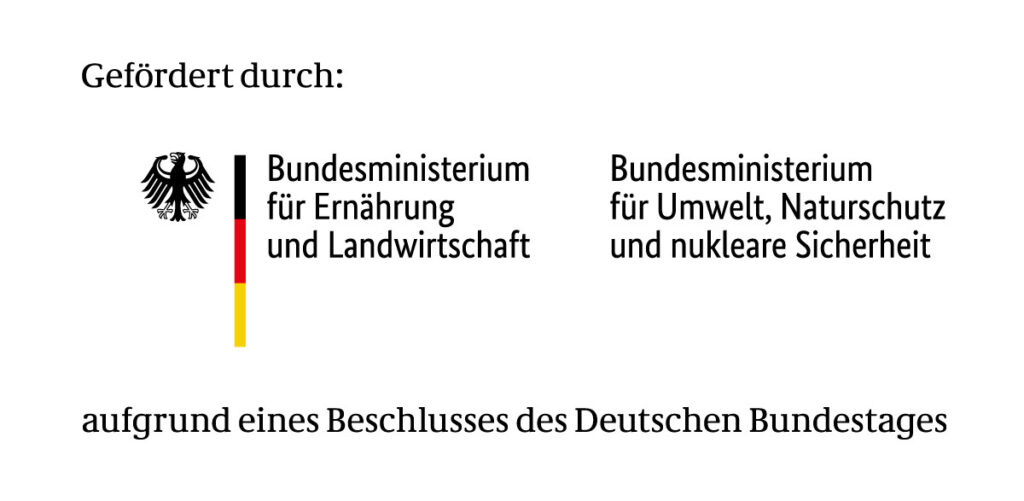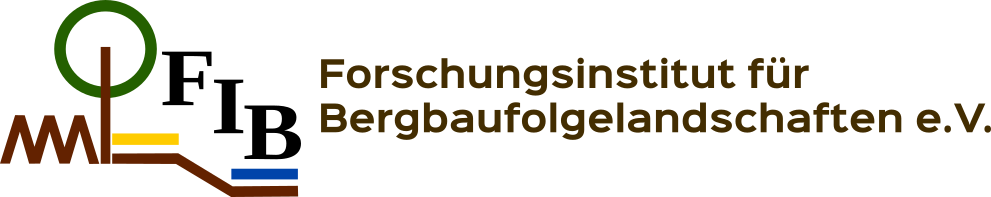Die Weinregion Mosel steht vor tiefgreifenden Herausforderungen: Klimawandel, zunehmende Ertragsrisiken und Kostendruck führen dazu, dass immer mehr Steillagen-Weinberge aus wirtschaftlichen Gründen aufgegeben werden oder brachliegen. Die Winzer kämpfen gegen den Preisverfall ihrer Produkte und schauen sich nach alternativen Kulturen für ihre Weinhänge um. Dabei rückt auch der Anbau von Lavendel als klimaangepasste Sonderkultur in den Fokus. Bei der Suche nach wertvollen Anknüpfungspunkten fragt der SWR nach den praktischen Erfahrungen im Lavendelanbau in der Lausitz bei Frau Dr. Rademacher vom FIB nach.
Autor: Christoph Ertle
Zukunftstag am 23.4. im FIB
Habt ihr euch auch schon mal gefragt: Was macht man eigentlich in so einem Forschungsinstitut? Wozu braucht man das? Unter dem Motto „Landschaftsforschung zum Anfassen“ gewinnt ihr am 23.April, dem Zukunftstag Brandenburg, Einblicke in unsere Arbeit – von der Feldversuchstechnik, über die Analyse im Umweltlabor bis hin zu fertigen Produkten aus verschiedenen nachwachsenden Rohstoffen. Meldet euch über Zukunftstag Brandenburg an! Wir freuen uns auf euch!
Nach Plan-Birke kommt Plan-BIO
Seit Anfang 2026 wird die biologische Vielfalt von Biotopbäumen in den Landkreisen Elbe-Elster und Oderspreewald-Lausitz gemeinsam mit der Öffentlichkeit erforscht. Das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit fördert das Vorhaben.
Das Projekt „PlanBIO – Bürgerforschung zur biologischen Vielfalt in Strukturwandelregionen − Erfassung, Bewertung & Monitoring von Biotopbäumen“ nutzt den Citizen Science Ansatz zur angewandten Landschaftsforschung im Lausitzer Braunkohlenrevier. Bürgerforscher*innen beobachten, kartieren und bewerten Biotopbäume, als ein Schlüsselelement biologischer Vielfalt.
Lasswissen bekommt Preis
Herzlichen Glückwunsch an den Förderverein des Naturparks Niederlausitzer Heidelandschaften zum Marketingpreis für den Forschungspfad LassWissen.
3. Preis in der Kategorie Land- und Naturtourismus
„Die Jury überzeugte das innovative Konzept, welches nachhaltigen Naturtourismus, interaktive Wissensvermittlung und Familienfreundlichkeit vereint, in dessen Mittelpunkt das wichtige Thema Verschwinden des Wassers als Folge der nachbergbaulichen Landschaftsentwicklung steht.“
Das FIB konnte in den letzten drei Jahren in dem Bürgerforschungsvorhaben LassWissen als Projektpartner mitwirken. Vielen Dank für die erfolgreiche und kreative Zusammenarbeit in der Region Elbe-Elster. Mehr zum Projekt
Besuch von Ministerpräsident Dietmar WoiDke
19. Januar 2026: Ministerpräsident Dietmar Woidke und Ministerin Hanka Mittelstädt besuchen den Stand der Agrar-, Ernährungs- und Landnutzungsforschung Brandenburg. Das FIB ist eine der sieben Einrichtungen dieser Gemeinschaft (https://agrarforschung-brandenburg.de).
Waldmehrung im Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft
Das FIB wurde vom Landesamt für Umwelt Brandenburg mit der Erarbeitung eines Gutachtens zur Waldmehrung im Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft beauftragt.
Ziel des Projektes ist es, die Eignung einer rund 15 ha großen, landeseigenen Fläche mit drei ehemaligen Klärteichen im Naturschutzgebiet „Bergbaufolgelandschaft Grünhaus“ für eine Erstaufforstung fachlich fundiert zu bewerten und die hierfür notwendigen Grundlagen zusammenzustellen. Damit soll der Flächenpool des Landesbetriebs Forst Brandenburg erweitert und die Voraussetzung für eine bedarfsgerechte und kurzfristige Umsetzung von Aufforstungsmaßnahmen geschaffen werden.
Die Durchführung kombiniert eine rechtliche, ökologische und bodengeologische Betrachtung des Sonderstandortes, der jahrzehntelang als Absetzbecken für Eisenhydroxid‑haltige Grubenwässer aus dem Tagebau Kleinleipisch genutzt wurde.
Neues EIP-Projekt „Cost-Efficient Irrigation“ offiziell gestartet
EIP-Projekt „Cost-Efficient Irrigation“
Im Projekt „Entwicklung von Entscheidungshilfen für eine kosteneffiziente Bewässerung – Cost-Efficient Irrigation (CEFIR)“ soll eine Entscheidungshilfe (DSS) entwickelt werden, mit der die Wirtschaftlichkeit der Bewässerung vor dem Bewässerungseinsatz abgeschätzt werden kann. Das DSS soll einerseits als einfach zu bedienende Web-App zur Verfügung gestellt und andererseits in eine vorhandene App zur Bewässerungssteuerung integriert werden.
Die Entwicklung erfolgt gemeinsam mit drei Landwirtschaftsbetrieben, deren Ackerschläge mit Kreisbewässerungsanlagen für Praxistests genutzt werden. Landwirtschaftliche Feldbewässerung kann mit dem DSS kosteneffizienter und nachhaltiger werden.
Fachworkshop mit Dr. Norbert Hoepfer am FIB
Der Bau- und Gebäudesektor braucht klimafreundliche Alternativen zu Zement & Co. Nachwachsende Rohstoffe wie Hanf, Schilf und Miscanthus sowie natürliche Bindemittel wie Kalk und Lehm punkten hier gleich doppelt – sie speichern CO₂ und stärken die regionale Wertschöpfung.
Genau hier setzte der Workshop „Hanf, Miscanthus und Paludi im Baustoff – Dämmsteine, Leichtbeton und Mörtel“ an, den neuwerg am 20./21.11.2025 in Finsterwalde mit Dr. Norbert Hoepfer ausrichteten. Die Teilnehmenden – Handwerker, Lehmbauer, Planer, Architekturbüros, Baustoffhändler und Bauherren – erlebten Theorie und Praxis zu Naturbaustoffen.
Die Resonanz war durchweg positiv: Das Zusammenspiel aus historischem Kontext, fundierter Materialkunde und eigenhändigem Experimentieren vermittelte ein umfassendes Verständnis für nachwachsende Dämm- und Mauerstoffe. Die Teilnehmenden nahmen nicht nur selbst hergestellte Proben, sondern vor allem frisches Know-how, Kontakte und neue Projektideen mit nach Hause – ein wichtiger Schritt hin zu klimafreundlichem, kreislauforientiertem Bauen in Brandenburg.
Mehr zum Workshop und zu nachwachsenden Rohstoffen gibt es auf der Seite von neuwerg (https://neuwerg.de/).
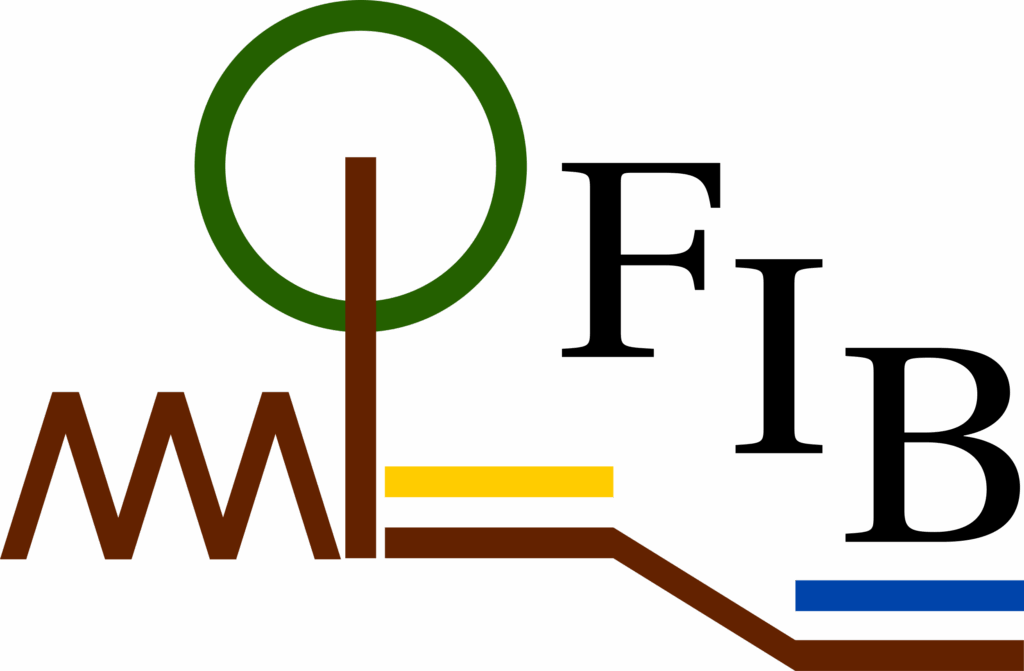


Forschungspreis geht an das FIB in Finsterwalde
Der 2023 erstmals ausgeschriebene Wissen der Vielen – Forschungspreis für Citizen Science würdigt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für herausragende wissenschaftliche Leistungen in der Anwendung von Citizen Science. In folgenden Medien sind weitere Information zum Forschungspreis zu finden: Website , LinkedIN, Bluesky, Mastodon, Instagram.
Ausgezeichnet wurden die Veröffentlichungen „Gemeinsam die Birke erforschen, Bürgerforschung zum Waldwandel: Wasserhaushalt, Biodiversität & Klimawirksamkeit (Teil 1)“ und „Messen, Auswerten & Verstehen (Teil 2)“. Beide Publikationen verdeutlichen, dass viele neu gewonnene Erkenntnisse ohne die zahlreichen und besonders engagierten Bürger*innen nicht möglich gewesen wären.
Klimafolgen wie Trockenheit verändern und bedrohen unsere Wälder. Die Studie ist ein wertvoller Beitrag zur Diskussion um deren Resilienz und weist den Weg für eine zukunftsfähige Forstwirtschaft mit artenreichen Mischbeständen. Im Fokus steht die allgegenwärtige, aber waldbaulich bislang weniger beachtete Gemeine Birke. Als robuste und verjüngungsfreudige Pionierbaumart unterstützt sie den ökologischen Waldwandel, insbesondere nach Schadereignissen. Doch bislang fehlten grundlegende ökologische Kenntnisse und Messdaten.
Im Projekt PlanBirke plus C forschten daher Wissenschaftler*innen und Bürger*innen gemeinsam zur Kohlenstoffbindung, zum Wasserhaushalt und dem Beitrag zur Biodiversität dieser Baumart. Unter anderem konnten Citizen Scientists mit der App PlanBirke selbstständig Messdaten sammeln oder in drei Modellregionen – Ruhrgebiet, Südbrandenburg & Nordsachsen – an „Bürgerlaboren“ im Wald und anderen Veranstaltungen teilnehmen.
Erstmals gelang dadurch die vergleichende Erfassung des ökosystemaren Wasserhaushaltes verschiedener Birken(misch)wälder in Mitteleuropa. Darüber hinaus erfolgte eine umfassende Datensammlung zur Kohlenstoffspeicherung – vom Stamm bis zum letzten Blatt. Schließlich ergab sich ein weiterer Erkenntnisgewinn bei ihrer oft unterschätzten Bedeutung als Habitatbaum. So stellt die Gemeine Birke einen Lebensraum für gefährdete Baumpilze sowie Totholzkäfer, Fledermäuse und andere Artengruppen dar. Damit zeigt PlanBirke plus C, was Bürger- und Gemeinsinn bei der Waldforschung leisten können.
Broschüren zum download:
PlanBirke plus C – Bürger erforschen den Waldwandel – Klimawirksamkeit, Biodiversität & Wasserhaushaltsfunktion wurde gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages im Rahmen des Waldklimafonds über der Projektträger Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FKZ: 2220WK29A5).
Projektpartner waren: Forschungsinstitut für Bergbaufolgelandschaften e. V., Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V. – Bundesverband und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e. V. – Landesverband Brandenburg.
In den drei Modellregionen unterstützen: Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, Staatsbetrieb Sachsenforst und Landesbetrieb Forst Brandenburg